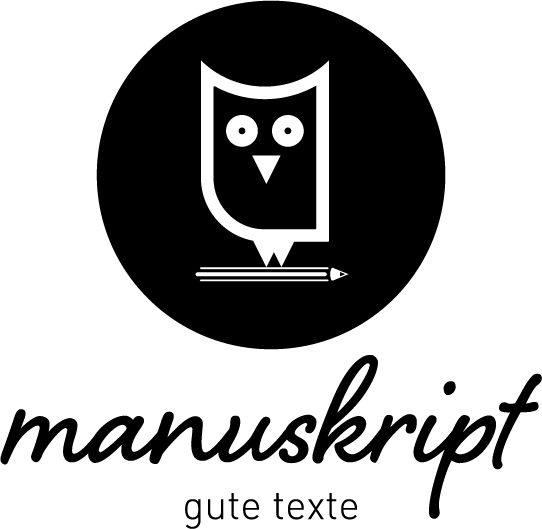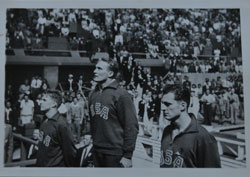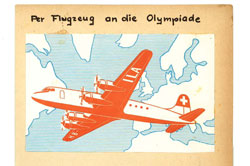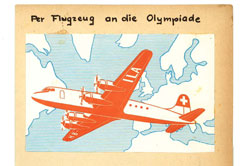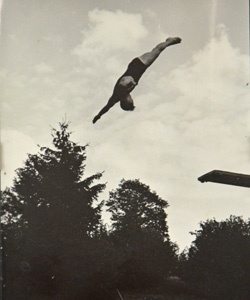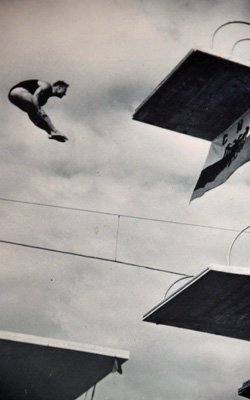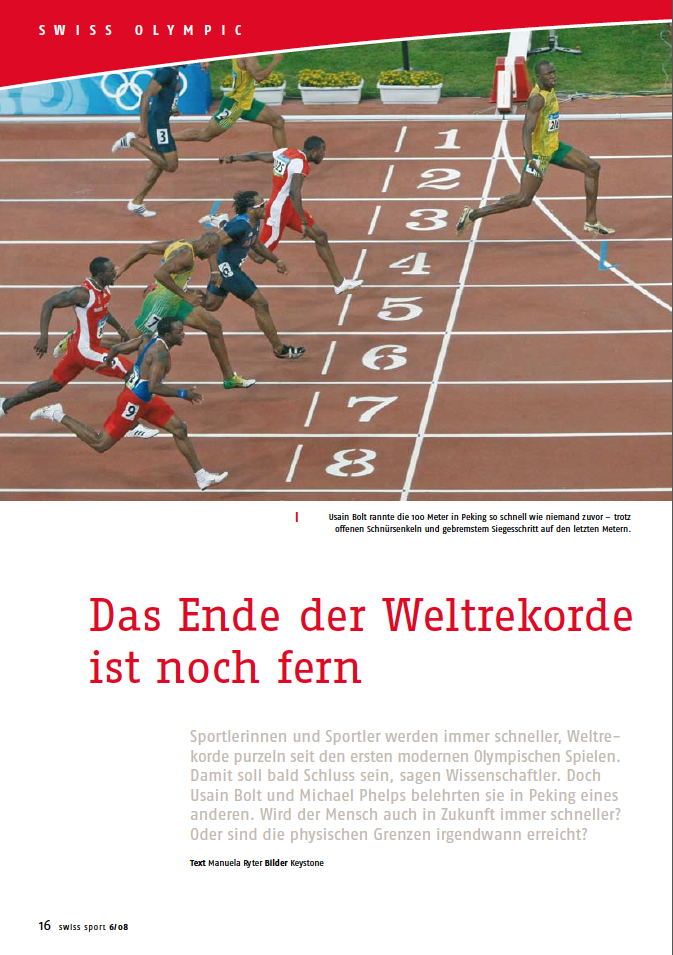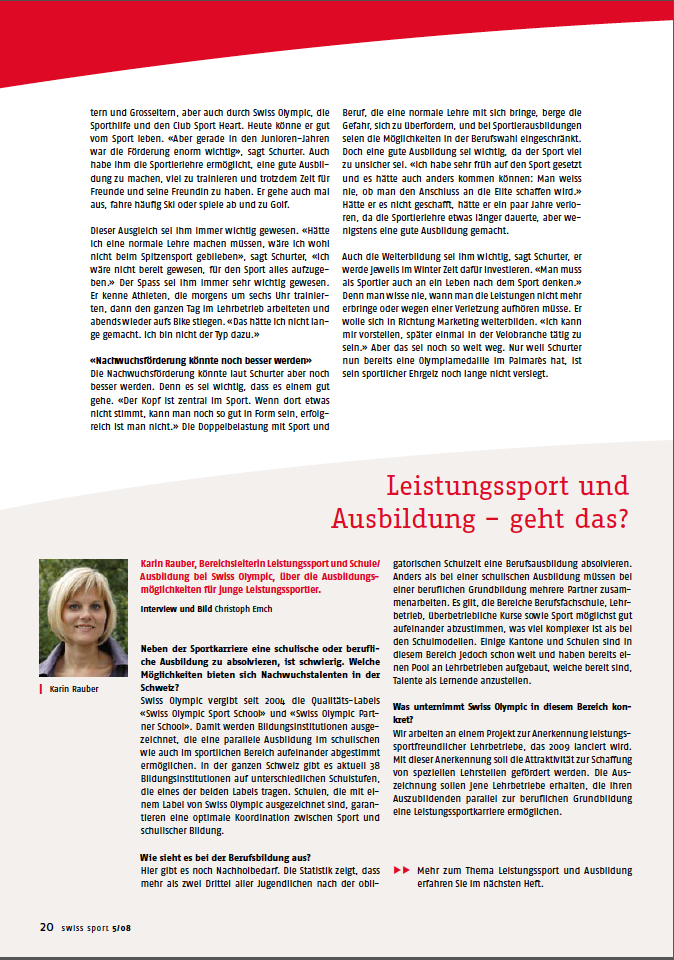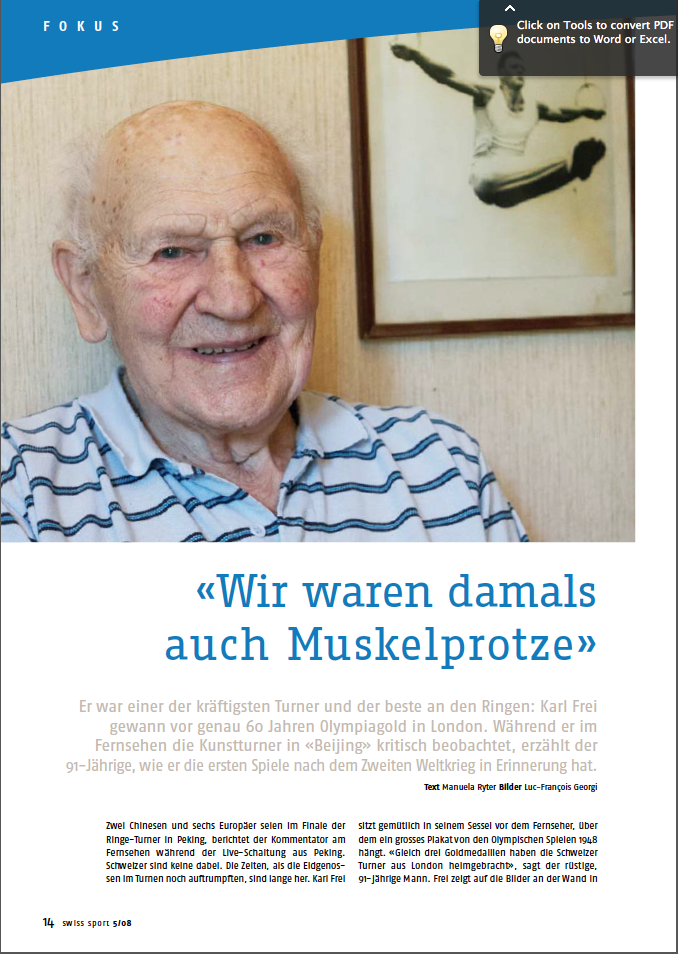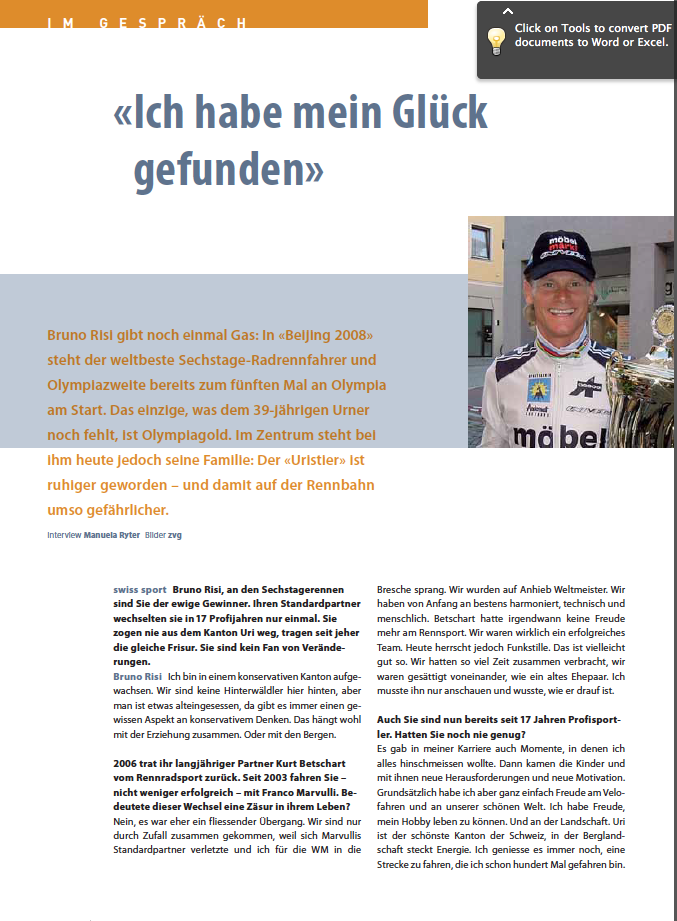Das fahrende Volk der Jenischen lud von Freitag bis Sonntag zur vierten Fekker-Chilbi in Brienz - und erinnerte an die Hunderten gestohlenen Kinder der Landstrasse.
Das Bild erscheint unwirklich. Hier die stolzen Chalets an der Brienzer Uferpromenade. Dort der See, der in die herbstliche Bergkulisse mündet. Und dazwischen der Wohnwagen von Martha Minster und ihrem Mann, welcher mit Ach und Krach zwei Zuckerwatten spinnt. Es ist Fekker-Chilbi in Brienz, der Märit der Jenischen, heuer bereits zum vierten Mal. Es ist die Chilbi, die zusammenbringt, was sich nicht kennt. Die Begegnungen ermöglicht zwischen den fahrenden und den sesshaften Schweizern. Denn dass sie Schweizer sind, betonen die Jenischen gerne. Dass sie genauso patriotisch sind. Wenn nicht gar eine Spur patriotischer, archaischer, urschweizerischer.
Die Marktstände der Fekker-Chilbi sehen aus wie aus dem Bilderbuch. Hier findet man nicht die immer gleichen Stände mit Magenbrot und Schuhwichse wie an den Dorfmärkten. Auch keinen Ramsch wie an den Trödlermärkten. An der Fekker-Chilbi verkaufen herausgeputzte jenische Frauen ausgesuchte Raritäten. Wertvolle antike Holzmöbel und alte Scherenschnitte. Retro-Spielautomaten und hochhackige Stöckelschuhe.
Es sind die Trouvaillen der Hausierer. Sie erzählen von der Freiheit der Fahrenden. «Wir sind frei wie die Vögel», schwärmt Alfred Werro. Er fährt wie die anderen 3000 bis 5000 Schweizer Jenischen, die noch nach ihrer traditionellen Kultur leben, von Frühjahr bis Herbst quer durch die Schweiz. Höchstens vier Wochen dürfen sie an einem Standplatz bleiben, dann ziehen sie weiter. An jedem neuen Ort gehen sie von Haustür zu Haustür, fragen nach Antiquitäten, Altmetall und nach Messern zum Schleifen.
Ein Hirsch steht ausgestopft und doch mit seiner gesamten Würde da und wartet, während am Stand gegenüber Hirschwürste verkauft werden. Von weitem erklingt Schwyzerörgeli-Musik. Ländler ist die Musik der Schweizer Jenischen, das Beweisstück ihrer helvetischen Tradition. Am Himmel dröhnen Kampjets und erinnern an das Böse.
Auch die Fekker-Chilbi erinnert in Filmen, mit Kunst und Diskussionen an ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte: 586 jenische Kinder wurden zwischen 1923 und 1972 vom «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der Pro Juventute von ihren Eltern getrennt und in Heime, Psychiatrien oder Gefängnisse gesteckt. Sie sollten zu «brauchbaren Gliedern der Gesellschaft» erzogen werden. Die «Vaganität» musste ausgerottet werden. Wer seine Kinder noch hatte, war jahrzehntelang auf der Flucht. «Wir konnten nicht zur Schule, die Angst war immer da», erzählt Werro, an seinen Marktstand gelehnt.
Nicht nur er – fast alle Jenischen an der Fekker-Chilbi sind direkt oder indirekt betroff en. Die Angst vor den «Sesshaften» wird an die nächsten Generationen weitergegeben. Die Fekker-Chilbi sei deshalb auch da, um die Fahrenden den «Sesshaften» wieder anzunähern und nicht nur umgekehrt, sagt Organisatorin Sandra Bosshart von der Radgenossenschaft der Landstrasse. Gestoppt wurde das «Hilfswerk» erst vor 40 Jahren (siehe Interview). Doch da war es für die meisten Betroffenen schon zu spät. Zurück blieben irre Mütter und verwundete Seelen.Noch heute tauchten immer wieder ehemalige «Kinder der Landstrasse» auf, die auf der Suche nach ihren Wurzeln seien, sagt Werro.
In Martha Minsters Topf kochen Schweinswürste, und auf den Festbänken sitzen alte Bekannte. Auch sie war ihren Eltern gestohlen worden. Die 71-Jährige schluckt leer. Ihre Geschichte ist lang und traurig. Ihre Kindheit ein Drama. Die Familienzusammenführung ein Desaster. Immerhin hatte sie ihre Mutter noch kennen gelernt. «Ich konnte ihr die Frage stellen, die mich während meiner Kindheit auffrass: weshalb sie mich nie besucht hatte.»
Nebenan dreht das fast schon historische Karussell seine Runden. Drei Kinder kreischen vor Freude.
Zur Sache:
«Unter dem Teppich»
Herr Caprez, können Sie sich noch daran erinnern, als eine jenische Mutter 1971 bei Ihnen im Büro stand und ihre Geschichte erzählte?
Ja. Ich konnte nicht glauben, dass das wahr war: Die Pro Juventute habe ihr alle fünf Kinder weggenommen, weil sie eine Jenische sei und im Wohnwagen leben wolle. 1952 wurde sie schwanger verhaftet. Das Kind wurde ihr nach der Geburt umgehend weggenommen.
Die Pro Juventute war damals eine angesehene Schweizer Institution. Die Frau hingegen war bereits vor Bundesgericht abgeblitzt. Weshalb glaubten Sie ihr?
Weil ich überzeugt war, dass sie nicht lügt. Sie erzählte alles so eindrücklich – solche Details kann man nicht erfi nden. Ausserdem fand ich bald glaubwürdige Zeugen.
Wie waren die Reaktionen auf den ersten Artikel im «Beobachter»?
Es gab extrem viele Reaktionen, und fast alle waren gegen mich. Auch die Presse
sprang nicht auf.
Wann kam die Wende?
Erst in den 80er-Jahren. Der neue Generalsekretär der Pro Juventute zeigte mir den Aktenberg über die Kinder der Landstrasse: Jeder abgefangene Brief, jedes Detail über die knapp 600 Kinder war magaziniert. Da kam alles aus, und es ging eine Welle der Entrüstung durch die Schweiz.
Wie kam es, dass dieses Unrecht nicht vorher an die Öff entlichkeit gelangt war?
Die Pro Juventute war eine heilige Kuh, und das «Hilfswerk» wurde von Bund, Kantonen und Gemeinden getragen. Man schaute das Vagantentum als Krankheit an, die sich auf Kinder überträgt. Die Propaganda zeigte stark verwahrloste Kinder – die Bevölkerung meinte, das Projekt sei eine gute Sache. Die echten Fotos zeigten dann ein ganz anderes Bild der Jenischen.
Was passierte danach mit den auseinandergerissenen Familien?
Man führte einzelne Familien zusammen. Es war eine Katastrophe, eine riesige Enttäuschung. Den Kindern war bisher erzählt worden, ihre Mütter hätten sie verlassen. Dieses falsche Bild der Eltern liess sich nicht einfach so ändern.
Haben die Jenischen seither wieder an Selbstvertrauen gewonnen?
Ja. Die Alten sind zwar immer noch zusammengestaucht, aber die Jungen haben mehr Selbstbewusstsein. Insgesamt geht es dieser Minderheit jedoch nicht so gut. Es fehlt an Standplätzen – und damit an Lebensraum –, und die Industrialisierung hat ihre Tätigkeiten weggeputzt. Wer lässt heute noch Messer schleifen?
Heuer feiert die Pro Juventute das 100-jährige Bestehen. Das dunkle Kapitel wurde an der 1.-August-Feier auf dem Rütli am Rande thematisiert. Reicht das?
Nein, das Thema wird nach wie vor unter den Teppich gekehrt. Die Pro Juventute könnte sich beispielsweise einsetzen, die Kinder der Landstrasse in die Schulbücher zu bringen. Denn dort gehört ihre Geschichte hin. (mry)