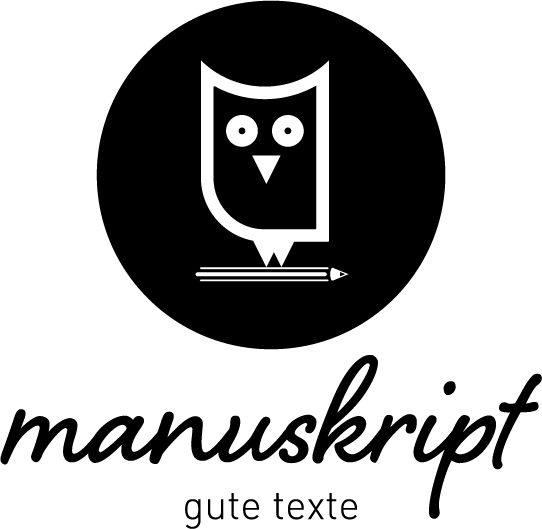«Tamilen sollen Dialog entfachen»
In Belp wurde der geplante hinduistische Tempel verhindert – der Verein Aum Shakti kämpft jedoch weiter.
In der Belper Aemmenmatt kann der hinduistisch-tamilische Verein Aum Shakti seinen Tempel nicht bauen. Die Tamilen werden nun nach einem neuen Standort suchen – im Stillen, um erneuten Widerstand zu verhindern.
Mehr als ein Jahr lang hatte der Verein Aum Shakti an seinem hinduistischen Tempelprojekt, das in der Belper Aemmenmatt geplant war, gearbeitet. Doch dann kam in Belp Widerstand auf und der Belper Gemeinderat entschied sich kurzfristig, just jenes Stück Land zu kaufen, auf dem der Tempel geplant war – mit der Begründung, Belp müsse wieder über Landreserven verfügen, um «die bauliche Entwicklung besser steuern zu können», wie der Belper Gemeindepräsident Rudolf Neuenschwander (sp) sagte. Vor zwei Wochen bewilligte die Belper Bevölkerung stillschweigend den politisch brisanten Landkauf. Das Projekt der Tamilen war damit innert kürzester Zeit und ohne jeden politischen Widerstand vom Tisch (der «Bund» berichtete).
«Wir werden nicht locker lassen»
«Die Gemeinde wollte uns das Land wegkaufen», sagt Dinesh Zala, der das Bauprojekt leitet. Rechtliche Schritte habe man jedoch nicht gegen die Gemeinde eingeleitet, sondern gegen die Verkäuferin, die Mavena AG. Diese habe ihnen das Grundstück versprochen gehabt und die Verhandlungen plötzlich abgebrochen, sagt Zala. «Wer bezahlt uns jetzt die 200 000 Franken, die wir in die Projektierung investiert haben?» Die Mavena begründete den Schritt gegenüber dem «Bund» damit, Aum Shakti habe es unterlassen, den Kaufvertrag rechtzeitig zu unterschreiben. Laut Zala wurden die Verhandlungen jedoch wegen einer Projektänderung durch die Mavena verzögert.
«Wir sind nach wie vor am Land interessiert», sagt Zala. Man werde deshalb bei der Gemeinde anklopfen: «Wir werden nicht locker lassen.» Laut Neuenschwander hat die Gemeinde Belp jedoch «nicht im Sinn, das Land in nächster Zeit zu verkaufen». Eine Anfrage der Tamilen werde man aber prüfen.
Projekt war zonenkonform
Man habe auch bereits mit der Suche nach einem neuen Standort begonnen, sagt Zala. Wo, will er jedoch nicht sagen – man wolle verhindern, «dass dies noch einmal passiert». Künftig werde er eine Bestätigung der Gemeinde, dass sie nicht gegen den Bau vorgehen werde, verlangen. In Belp hatte er nur eine Bauvoranfrage gemacht, um sicherzugehen, dass das Projekt zonenkonform sei. «Die Antwort fiel positiv aus, doch nun wurde der Bau trotzdem verhindert.»
Ohne Dialog keine Integration
Auch in der Gemeinde Lyss, wo heute ein Teil des Vereins Aum Shakti zu regelmässigen Treffen und Gottesdiensten zusammenkommt, hat man für das Vorgehen der Gemeinde Belp wenig Verständnis: Sie verstehe zwar, dass sich die Belper bedrängt fühlten, sagt Ursula Lipecki, SP-Fraktionspräsidentin und Ko-Leiterin der Integrationsgruppe in Lyss. «Aber es ist sehr beleidigend für die Tamilen, wenn man das Thema nicht einmal diskutiert.» Es sei in einer Demokratie hoch problematisch, wenn eine Gemeinde die Leute einfach vor den Kopf stosse, ohne den Dialog zu suchen. «So findet keine Integration statt», sagt Ursula Lipecki – mit diesem Vorgehen, «einer Art Rassismus», werde das Problem vielmehr an eine andere Gemeinde abgeschoben.
«Jetzt Verbündete finden»
Es sei jetzt jedoch auch an den Tamilen selber, den Dialog aufzunehmen, statt sich als Opfer zu fühlen und sich zurückzuziehen, sagt Usula Lipecki: Sie hätten bisher in der Schweiz sehr versteckt gelebt, «nun wollen sie etwas von der Gemeinschaft Schweiz, also müssen sie sich mit der Gesellschaft, in der sie leben, auch auseinander setzen, sich öffnen und Verbündete finden».
In Lyss unauffällig
Viele Mitglieder von Aum Shakti seien in Lyss sesshaft, «ihr Anspruch auf einen Raum, wo sie ihre Religion ausüben können, ist deshalb legitim», sagt Lipecki. Der tamilische Verein falle in Lyss nicht negativ auf, bestätigt Gemeindepräsident Hermann Moser (fdp). Hier habe dieser noch keine Anfrage für einen Landkauf gemacht. Dass die Suche nach geeignetem Bauland auch in Lyss nicht einfach wäre, räumt Moser allerdings ein: «Unser Zonenplan hat keinen Platz für Kultusbauten vorgesehen.» Wenn jedoch eine Anfrage auf den Tisch läge, «müsste man dies prüfen», sagt Hermann Moser – bei der nächsten Ortsplanung werde die Gemeinde das Thema Kultusbauten jedenfalls mit Sicherheit diskutieren. Seiner Meinung nach sollten solche Bauten möglich sein, «sie sollten jedoch der Gemeindegrösse angemessen sein».
Tempel für die Göttin
Ein Kleinprojekt plant Aum Shakti allerdings nicht. Während sich der Verein – nach der Göttin benannt, die er anbetet – in der Gemeinde Lyss in einem kleinen Raum trifft, würde der Tempelneubau auch weiteren Vereinsgruppen zur Verfügung stehen: Geplant war in Belp ein Kubusbau mit einer kleinen Kuppel, in dem sich einmal wöchentlich 250 bis 300 Personen treffen würden. Während der Woche würden ausserdem vierzig bis fünzig Knaben und Mädchen in tamilischer Schrift, Sprache und Kultur unterrichtet.
Interview mit Mathias Kuhn, Assistent am Institut für öffentliches Recht der Universität Bern.
«Gemeinde ist keine Investorin»
«Bund»: Herr Kuhn, Sie sind Mitautor einer Studie über die «bau- und planungsrechtliche Behandlung von Kultusbauten». Wo liegen die Konflikte?
Mathias Kuhn: Das Hauptproblem ist, dass nur wenige Gemeinden Zonenpläne haben, die Kultusbauten zulassen. Vielen Gemeinden war beim Erlass ihrer Nutzungsordnungen nicht bewusst, dass hier ein raumrelevantes Bedürfnis besteht. Durch die Migration sind in den letzten Jahren viele Glaubensgemeinschaften gewachsen. Diese Gruppierungen möchten nun neue Glaubensstätten errichten oder bestehende Gebäude umnutzen. In vielen Orten ist dies aber nicht möglich, da eine entsprechende Baute oft nur in Zonen für öffentliche Nutzungen zulässig ist. Dort ist jedoch meist kein Bauland vorhanden.
In Belp sind Kultusbauten in Gewerbe- und Arbeitszonen noch nicht verboten. Verhindert wurde das Projekt der Tamilen trotzdem.
Es ist sehr schade, wenn eine fortschrittliche Gemeinde wie Belp einen Schritt zurück macht. Andere Gemeinden, etwa die Stadt Bern, gingen in eine andere Richtung: Hier wurden Zonen so definiert, dass Kultusbauten möglich sind. Aber gerade weil dies in den meisten Gemeinden noch nicht der Fall ist, ist es verständlich, dass die Gemeinde Belp eine Ballung befürchtet, nachdem sie schon der serbisch-orthodoxen Kirche eine Baubewilligung erteilt hat. Es wäre jedoch ehrlicher gewesen, wenn sie dies offen kommuniziert hätte. Stattdessen wurde die Diskussion umgangen, um nicht mit dem Vorwurf der Ungleichbehandlung oder gar der Diskriminierung konfrontiert zu werden.
Hat Belp mit seinem Vorgehen die Glaubensfreiheit verletzt?
Nein. Es liegt kein unzulässiger Eingriff in die Glaubens- und Gewissensfreiheit vor, wenn Kultusbauten in bestimmten Zonen verboten werden. Es ist gerade der Sinn der Nutzungspläne, dass nicht überall alles gebaut werden kann. Massagesalons, Friedhöfe oder Kehrichtverbrennungsanlagen sind auch nicht überall zulässig. Problematisch ist allerdings Belps Vorgehen: Das Instrument zur Steuerung der baulichen Entwicklung ist die Ortsplanung. Eine Gemeinde hat jedoch nicht die Funktion, als Investorin aufzutreten und mit einem Landkauf direkt in die freie Marktwirtschaft einzugreifen, ohne dass ein klares Bedürfnis – etwa für den Bau eines Schulhauses – vorhanden ist.
Der Verein Aum Shakti wird nun einen neuen Standort suchen. Beginnt für ihn damit ein Spiessrutenlauf durch die Gemeinden?
Man sollte das Thema in einen politischen Prozess einbringen und nicht auf kommunaler Ebene, sondern regional oder kantonal angehen. Auf Gemeindeebene sind die politischen Hürden riesig. Für die Integration dieser Gruppen ist es jedoch wichtig, dass sie ihre Religion ausüben können. Der Kanton könnte den Gemeinden im Richtplan den Auftrag geben, Kultusbauten zu ermöglichen. Er könnte das Platzproblem auch besser koordinieren. Denn viele Glaubensgemeinschaften haben ein grosses Einzugsgebiet: Die Mitglieder kommen von weit, um sich an einem Ort zu treffen.
Text und Interview: Manuela RyterDieser Artikel erschien am 29. September 2007 im "Bund".