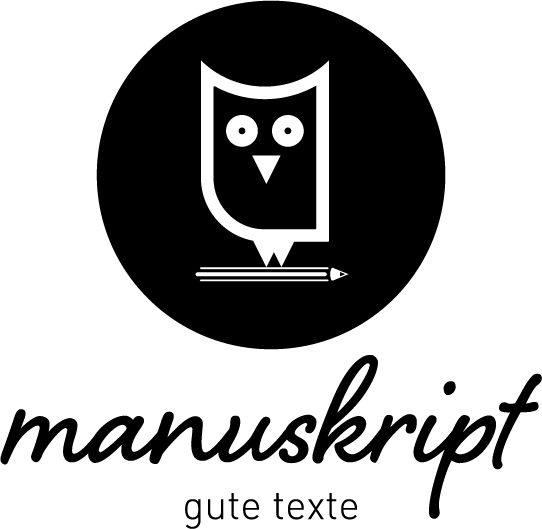Punkto Ausmass und Behandlung der «Zeckenkrankheit» Borreliose scheiden sich die Geister
Forscher und Mediziner streiten über Diagnose und Behandlung der von Zecken übertragenen Krankheit Lyme-Borreliose - und verunsichern damit Patienten: Sind deren unerklärliche Symptome, die von Müdigkeit bis zu Lähmungserscheinungen reichen, auf die «Zeckenkrankheit» zurückzuführen?
Es war im März 1998, als Frau S.* zum ersten Mal wegen unerklärlicher Gelenkschmerzen zum Arzt ging. Diagnose: eine bakterielle Infektion durch Streptokokken. Doch die Symptome blieben trotz Behandlung: Ständig hatte sie leichtes Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen, Augenbrennen, Halsweh, Kopfweh oder Konzentrationsstörungen - und niemand wusste recht warum. Im Dezember machte der Hausarzt Blutuntersuchungen. Aber auch sie brachten keine neuen Erkenntnisse. Die Krankheit wurde mit jedem Tag schlimmer. Im April 1999 wurde die selbständige Biologin - bereits seit Monaten bis zu 50 Prozent arbeitsunfähig - ins Spital eingewiesen. «Die Laborwerte ergaben jedoch auch nichts. Die Ärzte sagten, ich sei in den Wechseljahren. Aber ich war knapp 44. Man zweifelte an meiner psychischen Gesundheit, das war der Tiefpunkt meiner Krankheitsgeschichte», sagt Frau S.
Durch Bekannte kam sie zu Laurence Meer, einer Ärztin in Flamatt, die zur «Zeckenkrankheit» Lyme-Borreliose forscht. Diese untersuchte die Blutproben, und im Februar 2000, zwei Jahre nach dem ersten Arztbesuch, kam die Diagnose: Lyme-Borreliose, eine bakterielle, von Zecken übertragene Infektion, bereits im chronischen Stadium (siehe Kasten rechts).
Streit unter Experten
Borreliose-Diagnosen sind der unspezifischen Symptome der Patienten wegen häufig nicht ganz eindeutig und deshalb umstritten. Universitätsmediziner glauben, dass es kaum chronische Borreliose-Patienten gibt. Zeckenspezialisten sehen das anders - punkto Behandlung sind jedoch auch sie untereinander zerstritten.
«Den Verdacht auf Borreliose hatte ich immer, denn ich hatte etliche Zeckenbisse», sagt Frau S. Die typische Wanderröte, einen kreisförmigen Ausschlag um die Stichstelle, hat die Biologin jedoch nie bemerkt. Und ein weiterer Bluttest sei nach dem ersten negativen nie zur Diskussion gestanden. Seither ist Frau S. bei Meer in einer Langzeit-Antibiotikabehandlung. Nun gehe es ihr besser, sagt sie.
Das könne nicht sein, sagt Norbert Satz, der in Zürich eine Praxis für «Zeckenkrankheiten» führt: «Chronische Patienten kann man nicht mit Antibiotika behandeln, da hilft nur Symptombekämpfung, zum Beispiel mit Schmerzmitteln», sagt er. Frau S. würde es seiner Meinung nach ohne Antibiotika genauso gut gehen. Und Stefan Zimmerli, Infektiologe am Inselspital in Bern, geht noch weiter: «Chronische Borreliose-Patienten sind höchst selten», sagt er. Die Diagnose werde von «so genannten» Spezialärzten viel zu häufig gestellt.
Krankheit nicht beweisbar
Ob zu häufig oder zu selten - die Krankengeschichten von chronischen Lyme-Borreliose-Patienten sind fast immer gleich: jahrelanges Leiden, eine Odyssee von Arzt zu Arzt, unterschiedliche Diagnosen und Therapien, verwirrte Betroffene. Denn ohne Wanderröte, die nur bei jedem Dritten auftritt, wird die Krankheit oft nicht oder zu spät erkannt, da der Zeckenbiss in den meisten Fällen nicht bemerkt wird.
Wenn die Infektion sofort behandelt wird, ist sie gut heilbar. Bereits nach mehreren Monaten werden jedoch sowohl Diagnose als auch Behandlung schwieriger: Die Symptome könnten auch andere Ursachen haben, und die Bakterien sind schlechter durch Antibiotika bekämpfbar. Ausserdem haben rund zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung Borrelien-Antikörper im Blut - die das Immunsystem zur Bekämpfung der Erreger produziert - und sind dennoch gesund. Ein positiver Bluttest ist somit kein Beweis für die Krankheit. «Eine Ja- oder Nein-Diagnose ist nicht möglich: Es braucht ein typisches Beschwerdebild, positive Laborwerte und einen Ausschluss aller anderen möglichen Krankheiten», sagt Borreliose-Arzt Norbert Satz.
Gerade die Einschätzung, ob chronische Schmerzen psychisch bedingt sind oder nicht, fällt jedoch von Arzt zu Arzt unterschiedlich aus. Psychiatrie oder Antibiotika - eine für den Patienten schwer wiegende Entscheidung, die nicht selten zu Problemen mit Versicherungen und Krankenkassen führt (siehe Text unten links).
Wie heikel die nicht beweisbare Diagnose und das somit nicht abschätzbare Ausmass der Borreliose ist, zeigt ein Blick ins Internet, Hauptinformationsquelle vieler Patienten: Weltweit gibt es etliche Selbsthilfegruppen und Organisationen, die vor der «Gefahr Borreliose» warnen, unzählige Websites mit Informationen und Foren. Die Kranken fühlen sich von den Ärzten im Stich gelassen.
Gefahr oder Bagatelle
«Die Lyme-Borreliose ist eine meist harmlose, problemlos behandelbare bakterielle Infektion, die nur in seltensten Fällen zu langen Krankheitsverläufen führt», sagt Infektiologe Stefan Zimmerli zur Haltung der Universitätsmediziner. Die Borreliose-Krankheit werde von Randgruppen «hochstilisiert und mit unbestimmten Symptomen in Zusammenhang gebracht, die nichts mit der Lyme-Borreliose zu tun haben - dies ist ein Trugschluss», so der Oberarzt. Wenn ein Patient nach einer Antibiotikatherapie Beschwerden habe, seien diese mit Ausnahme von ganz wenigen Fällen nicht auf ein Weiterbestehen der Infektion zurückzuführen - chronische Borreliose-Patienten würden somit kaum existieren.
Diese Aussage findet Norbert Satz «völlig daneben»: Chronische Fälle seien in der Schweiz ein sehr grosses Problem. «Wer dies nicht wahrhaben will, sitzt in einem Elfenbeinturm.» Seiner Meinung nach werden etwa zehn Prozent der 3000 bis 5000 Personen, die sich jährlich mit dem Bakterium infizieren, chronisch und zum Teil ernsthaft invalidisiert.
«Es fehlt Schlüsselstelle»
Laurence Meer, die zu Langzeitbehandlung und Zusatzinfekten forscht und publiziert, arbeitet zusammen mit der technischen Hochschule Biel an einem Programm zur Erfassung der Patienten. «Es fehlt eine Schlüsselstelle, wo Patienten über längere Sicht beobachtet werden - sie sind bei Hautärzten, Rheumatologen, Psychiatern oder Neurologen verzettelt», sagt Meer.
Auch bei den Testverfahren sieht sie Lücken: Entgegen der Meinung anderer Ärzte teilt sie die Ansicht, dass ein Bluttest trotz Krankheit negativ sein könne, da die Bakterien ihre Eiweissoberfläche laufend änderten, was die Antikörperbildung und damit den Nachweis erschwere. «Deshalb sollte der PCR-Test, der Teile der DNA nachweist, verbessert werden», so Meer. Es sei jedoch schwierig zu wissen, in welchem Gewebe das Erbgut am ehesten zu finden sei.
Doch auch an diesem Testverfahren scheiden sich die Geister. Und der Streit um die nicht sicher beweisbare Krankheit Lyme-Borreliose geht weiter.
* Name der Redaktion bekannt
Interview mit Hanspeter Zimmermann, Epidemiologe beim Bundesamt für Gesundheit BAG.
«Keine harmlose Krankheit»
«Bund»: Es herrschen grosse Meinungsverschiedenheiten zur Diagnose, Behandlung und zum Ausmass der von Zecken übertragenen Krankheit Borreliose. Wie schätzen Sie die Situation in der Schweiz ein?
Hanspeter Zimmermann: Das Ausmass der Borreliose-Krankheit ist nicht ganz klar. Man kann jedoch nicht sagen, es sei eine harmlose Krankheit: Sie ist weder einfach noch selten. Die Schwierigkeit liegt bei der Diagnosestellung: Ein einzelner Labortest reicht nicht aus, um sie klar zu bestimmen. Die Diagnose Borreliose wird von Teilen der Ärzteschaft zu häufig, von andern zu selten gestellt. Wir rechnen mit schätzungsweise 3000 Erkrankungsfällen pro Jahr. Aber der grösste Teil davon sind Patienten mit Erythema migrans, der Wanderröte, einer grundsätzlich harmlosen Krankheit. Die Schwierigkeit kommt bei den Patienten ohne Wanderröte, denn viele Leute haben Antikörper und hatten nie Borreliose-Symptome. Gemäss Spitalstatistik gibt es im Schnitt jährlich 200 bis 300 Spitaleinweisungen mit der Diagnose Borreliose.
Nimmt das BAG zum herrschenden Konflikt unter Medizinern und zwischen Ärzten und Patienten Stellung?
Nein, das BAG kann zu dem Konflikt nicht Stellung nehmen. Unsere Aufgabe ist es, die Krankheit zu überwachen: Wie häufig ist sie, bei wem und wo taucht sie auf? Wir machen Empfehlungen, wie Krankheiten verhütet werden können, aber wir mischen uns nicht in die Behandlung der Patienten ein.
Ist die Überwachung der Lyme-Borreliose beim BAG ein Thema?
Ja, die Lyme-Borreliose ist auch für uns ein Thema. In einer Arbeitsgruppe wird zurzeit überlegt, wie wir die Krankheit besser überwachen können. Wir wollen abschätzen können, was diese Krankheit in der Schweiz bedeutet, denn sie kann sehr schwer verlaufen. Bis im Jahr 2003 bestand obligatorische Meldepflicht. Die Ergebnisse sind jedoch nur von begrenzter Hilfe, da damit die schwereren Erkrankungen, wie etwa die neurologischen Erscheinungen, nicht erfasst werden konnten.
Die chronischen Borreliose-Fälle könnten mit verbesserten Testverfahren einfacher bestimmt werden. Unterstützt das BAG solche Forschungsprojekte?
Wir unterstützen primär Forschung im Bereich der Überwachung der Epidemiologie, dazu gehören in gewissen Fällen auch PCR-Untersuchungen. Im Falle der Borreliose ist dieses Testverfahren jedoch nicht das Mittel, um die Problematik aufzuarbeiten. Zur Erfassung der schweren Borreliose-Fälle müssen weitere Hilfsmittel angewendet werden, wie zum Beispiel ein mehrseitiger Fragebogen wie in den USA.
Konnten in der Schweiz gewisse Risikogebiete lokalisiert werden?
Die ganze Schweiz unterhalb von 1200 bis 1500 Metern über Meer ist Risikogebiet. Der Anteil der infizierten Zecken schwankt jedoch stark, auch lokal: von 5 bis 50 Prozent. Bisher konnte man jedoch keine speziellen Gebiete aussondern. Die geografische Lokalisation, also die Verteilung der Borreliose-Patienten, würde sicherlich auch in die neuen Untersuchungen kommen.
Kasten:
Kostenfrage: Unfall oder Krankheit?
Chronische Borreliose-Patienten sind teuer: Über Jahre hinweg sind Arzt- und Spitalbesuche, Medikamente und aufwändige Laboruntersuchungen nötig. Dazu kommt die häufige Erwerbsunfähigkeit und nicht selten sogar Invalidität. Grundsätzlich gilt ein Zeckenstich als Unfall - also muss die Unfallversicherung bezahlen. Bei Patienten mit Wanderröte ist der Fall klar. Schwieriger wird es jedoch bei chronischen Patienten, die sich an keinen Zeckenstich erinnern.
Hier erschweren die unklaren Diagnosemöglichkeiten und der Konflikt um das Ausmass der Krankheit (siehe Text oben) auch die rechtliche Beurteilung, wer für die hohen Kosten aufkommen muss: Kann der Arzt die Diagnose Borreliose glaubhaft beweisen, bezahlt die Unfallversicherung. Wird die Diagnose jedoch angezweifelt, bezahlt die Krankenkasse, wobei die Leistungen im Falle eines Unfalls viel grösser sind als bei Krankheit.
Streit bis vor den Richter
«Viele chronische Borreliose-Patienten stehen in ständigem Streit mit Versicherungen», sagt Borreliose-Ärztin Laurence Meer. Das Versicherungsdossier ihrer Patienten sei mindestens gleich dick wie das der Krankenberichte.
Für Beat Cartier, Facharzt für Arbeitsmedizin bei der Suva, ist der Fall klar: Chronische Borreliosen sind selten. «In unklaren Fällen wird die schulmedizinische Fachmeinung durch universitäre Gutachten eingeholt», sagt er. Diese stünden zum Teil im Widerspruch zu den Arztberichten der behandelnden Ärzte - auch solcher, die sich auf eine grosse Borreliose-Erfahrung beruften. In einigen Fällen pro Jahr ende der Streit vor dem Richter.
Wenn die Unfallversicherung den Fall ablehnt, bezahlt die Krankenkasse - teure und umstrittene Therapien kann sie jedoch ablehnen. Wie verschiedene Krankenkassen bestätigten, sind solche Problemfälle jedoch höchst selten. (mry)
«Zeckenkrankheiten»
Die durch Zecken übertragene Krankheit Lyme-Borreliose, die durch das 1983 vom Schweizer Willy Burgdorfer entdeckte Bakterium Borrelia burgdorferi hervorgerufen wird, verläuft in drei Stadien: Im Lokalstadium kann ein Hautausschlag, das so genannte Erythema migrans, auftreten. Erste Anzeichen sind zudem grippeähnliche Symptome. Antibiotika sind sehr wirksam. Im Akutstadium befallen die Bakterien die Organe, besonders Gelenke, Haut und Nervensystem. Im chronischen Stadium können bleibende Schäden auftreten wie Arthrose oder Lähmungen. Daneben können Müdigkeit, Kopf-, Nacken- und Muskelschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sowie Depressionen und Rheuma auftreten. Die Vielzahl an Symptomen macht die Diagnose sehr schwierig. Die Borreliose darf nicht mit der FSME-Hirnhautentzündung, einer Vireninfektion, die ebenfalls von Zecken übertragen wird, verwechselt werden. FSME-Fälle sind seltener, aber es ist keine Behandlung möglich. Es existiert eine Impfung, die Bewohnern in Risikogebieten empfohlen wird.
Risikogebiete für Borreliose sind bisher kaum erforscht (siehe Interview). Im Schnitt ist jede dritte Zecke infiziert. Eine Impfung gibt es nicht. Die Gefahr, nach einem Zeckenstich an Borreliose zu erkranken, wird zurzeit an der Universität Neuenburg erforscht. Um Zeckenstiche zu vermeiden, soll man im Wald lange Kleidung tragen und danach den Körper absuchen. Zecken (ein bis sechs Millimeter gross) leben nicht auf Bäumen, sondern im Unterholz.
Text: Manuela Ryter
Diese Hintergrundseite erschien am 13. September im "Bund".